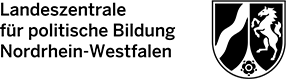„Die neue Bundesregierung muss den Konfliktmechanismus wieder professionalisieren“
In Berlin tritt am 25. März der neu gewählte Bundestag zusammen. Zugleich verhandeln Union und SPD über die Bildung einer neuen Regierung. Prof. Dr. Karl-Rudolf Korte ist Politikwissenschaftler und Direktor Emeritus der NRW School of Governance em. Im Gespräch mit der Landeszentrale sagte er, warum er zuversichtlich auf die Koalitionsverhandlungen blickt und was die neue Regierung anpacken muss, damit sie bis zum Ende der Legislatur durchhalten kann.

Herr Professor Korte, Sie sind Politikwissenschaftler, aber auch Bürger dieses Landes. Wie blicken Sie auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen?
Ich blicke ihnen positiv entgegen, weil wir im Vergleich zum europäischen Parteienwettbewerb in Deutschland einen Sonderweg gehen. Wir haben eine heterogene und breite Mitte, die viele unterschiedliche Interessen einbindet und dabei handlungsfähig ist. Eine Polarisierung gibt es an den Rändern, aber der Mitte gelingt es weiterhin, Einigungen zu erzielen und Konflikte in Lösungen zu übersetzen. Das unterscheidet Deutschland von vielen anderen europäischen Ländern.
Was schätzen Sie - wie lange wird es dauern, bis eine neue Bundesregierung im Amt ist?
Im Durchschnitt dauern Sondierungsgespräche 10 Tage und Koalitionsverhandlungen 70 Tage. Das wissen wir aus der Parlamentarismusforschung. Aber daraus lässt sich nicht vorhersehen, wie lange die anstehenden Verhandlungen dauern werden. Die Einigungen der letzten Tage haben uns einen ersten Eindruck gegeben, auch zu dem, was die Grünen hineinverhandelt haben. All das muss jetzt in ein Regierungsprogramm übersetzt werden, was sicher auch experimentelle Ansätze erfordert.
Wie lange dürfen Koalitionsverhandlungen verfassungsrechtlich dauern?
Da gibt es keine Beschränkung. Zwingend ist, dass sich der neue Bundestag fristgemäß konstituiert. Aber wir haben keine regierungslose Zeit, weil die bisherige Bundesregierung geschäftsführend im Amt verbleibt. Lediglich der Bundespräsident kann, sozusagen als Kanzlermacher, Druck ausüben, indem er irgendwann sagt: Jetzt einigt euch. Das hat er 2017 getan, als die damalige Regierungsbildung in eine Blockade geraten war.
In einer neuen Bundesregierung werden in jedem Fall Partner zusammenarbeiten, die zu wichtigen Themen der Zeit unterschiedliche und auch einander ausschließende Ansätze vertreten. Ist das Segen oder Fluch für die Demokratie?
Das ist immer ein Segen. Es gibt in Deutschland sehr unterschiedliche Interessen und Kompromisskompetenz bedeutet, Willensbildung in Problemlösung zu überführen. In der Regel ist es so, dass die Parteien daran interessiert sind, nicht nur im Sinne einer Klientelpolitik die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern den gemeinsamen Verhandlungskuchen zu vergrößern. Damit sind am Ende sehr breite und unterschiedliche Interessen in die Regierungsarbeit eingebunden, was für eine Demokratie wichtig ist.
Was muss die neue Bundesregierung aus dem Scheitern der Ampel lernen, damit sie bis zum Ende der Legislatur durchhalten kann?
Sie muss den Konfliktmechanismus wieder professionalisieren. Konflikte sollen laut im Bundestag artikuliert werden, aber dem Kabinett muss es gelingen, diese Konflikte in Lösungen umzusetzen. Das hat die alte Bundesregierung nicht hinbekommen. Im Kabinett gab es vielleicht noch Ansätze der Einigung, aber in den Fraktionen sind diese dann regelmäßig verloren gegangen. Im Gesamtgefüge ist die alte Bundesregierung also nicht nur an fehlendem Geld gescheitert, sondern ganz wesentlich daran, dass ihr die Fähigkeit zur Konfliktregulierung abhandenkam.
Und wir Wählerinnen und Wähler - welche Erwartungen dürfen wir berechtigterweise an die neue Bundesregierung stellen, wo müssen wir uns von Erwartungen lösen?
Die hohe Erwartung vieler Menschen ist, dass wir eine Richtung bekommen, die funktionierenden Staat sichtbar macht. Dazu gehört auch eine Infrastruktur, die den Namen verdient. Wenn hier Problemlösungen kurzfristig sichtbar werden, auch über Experimentierfelder und Einzelprojekte, wird das Vertrauen in den Staat und seine politischen Institutionen auch wieder wachsen.