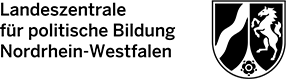Vieles sein in NRW
In Nordrhein-Westfalen verorten sich etwa ein Drittel der Menschen in mehr als einer kulturellen Herkunft. Sie haben eine Migrationsgeschichte, entweder aus eigener Erfahrung oder über ihre Vorfahren. Der größte Teil lebt schon lange hier. Ein Drittel kam in der Zeit zwischen 1959 und 1989 nach Deutschland. Ihre Nachfahren, in Deutschland geboren, beantworten höchst individuell, wie und wo sie sich selbst kulturell verorten.
Fakten
- Rund ein Viertel aller Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland leben in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung ist mit rund 44 Prozent in Bremen am höchsten.
- Zwei Drittel der Menschen in Deutschland haben schon Rassismus erlebt – direkt oder indirekt. Etwa jede fünfte Person ist selbst betroffen.
Vom „Migrationshintergrund“…
Den Begriff „Migrationshintergrund“ gibt es so nur im deutschsprachigen Raum. Darunter fasst das Bundesamt für Statistik Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, aber entweder selbst keine deutsche Staatsbürgerschaft oder bei Geburt in Deutschland mindestens ein Elternteil ohne deutschen Pass hatten. Auch die Behörden in Nordrhein-Westfalen nutzen diese Definition.
Das heißt: Sehr viele Menschen, denen allein aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes im Alltag häufig ein Migrationshintergrund zugewiesen wird, haben tatsächlich keinen. Wer aber zum Beispiel mit Staatsbürgerschaft aus Österreich oder der Schweiz in Deutschland lebt, ist statistisch „mit Migrationshintergrund“ erfasst.
Auch deshalb ist das Konzept „Migrationshintergrund“ umstritten. Die einen machen geltend, dass auch mit Migration verbundene soziale Phänomene wie Armutsrisiko oder geringere Bildungschancen erfasst werden müssen. Andere sagen: Der Begriff dient vor allem dazu, Zugehörigkeit abzusprechen und einen großen Teil der deutschen Gesellschaft auszuschließen.
…zum Zusammenleben in der postmigrantischen Gesellschaft
In der jüngeren Vergangenheit hat sich die Bezeichnung „postmigrantische Gesellschaft“ etabliert. In einer solchen haben viele Menschen zwar keine eigene Migrationserfahrung mehr, begreifen die migrantische Erfahrung in ihrer Familie jedoch als eigenen kulturellen Hintergrund und kollektive Erinnerung. In der postmigrantischen Gesellschaft bestimmen die Mitglieder selbst über Verortung und Identität.
Publikationen für die politische Bildung

Migrationsgesellschaft
Migrationsbewegungen haben unsere Gesellschaft in Deutschland und auch in Europa schon immer geprägt. Auch wenn das Zusammenleben insgesamt gut funktioniert, gab und gibt es immer wieder Spannungen und Konflikte. Die Fähigkeit, mit Diversität und Vielfalt umzugehen, ist deshalb eine tragende Säule einer weltoffenen Gesellschaft. Entsprechend zentralen Fragen wird daher in diesem Themenheft nachgegangen.
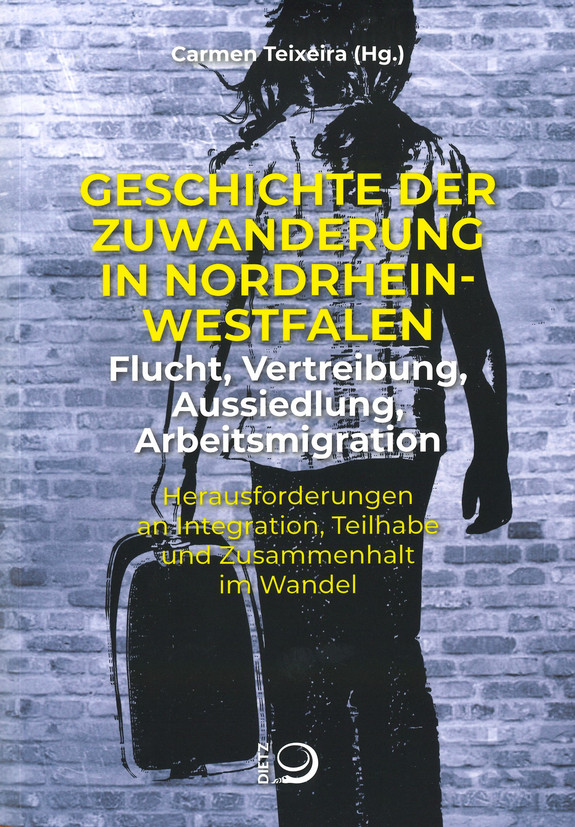
Geschichte der Zuwanderung in NRW
Zuwanderung gab es in Nordrhein-Westfalen schon immer. Sie ist ein wesentlicher Teil seiner Geschichte und prägte das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland.Dieses Buch spricht darüber in vielen persönlichen Zeugnissen und bietet außerdem Analysen und Hintergrundwissen zu Geschichte und Gegenwart der NRW-Migrationsgesellschaft.
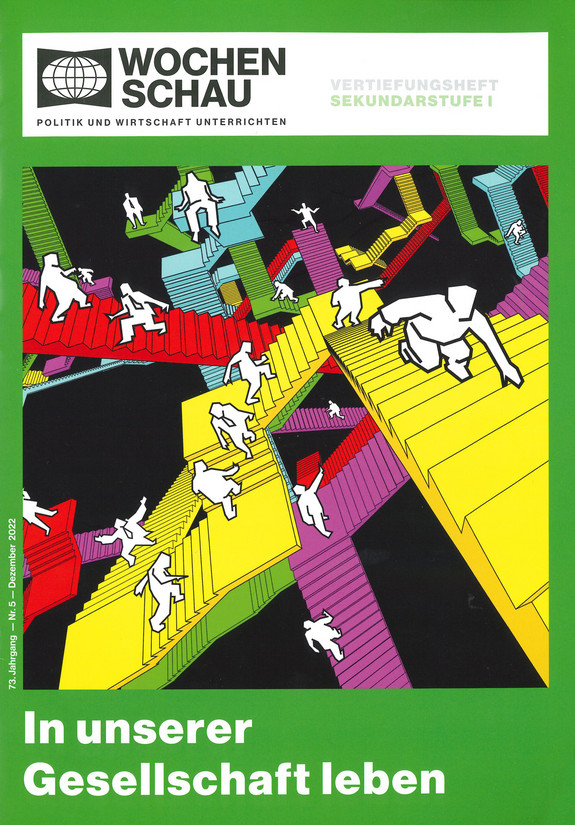
In unserer Gesellschaft leben
Uns Menschen gibt es nur in Gesellschaft. Wir sind soziale Wesen und teil unterschiedlicher Gemeinschaften - Familie, Klasse, Verein, usw. Alle Menschen, die in unserem Land leben, bilden unsere Gesellschaft. Was heißt eigentlich "In unserer Gesellschaft leben?" oder "In unsere Gesellschaft" integrieren?
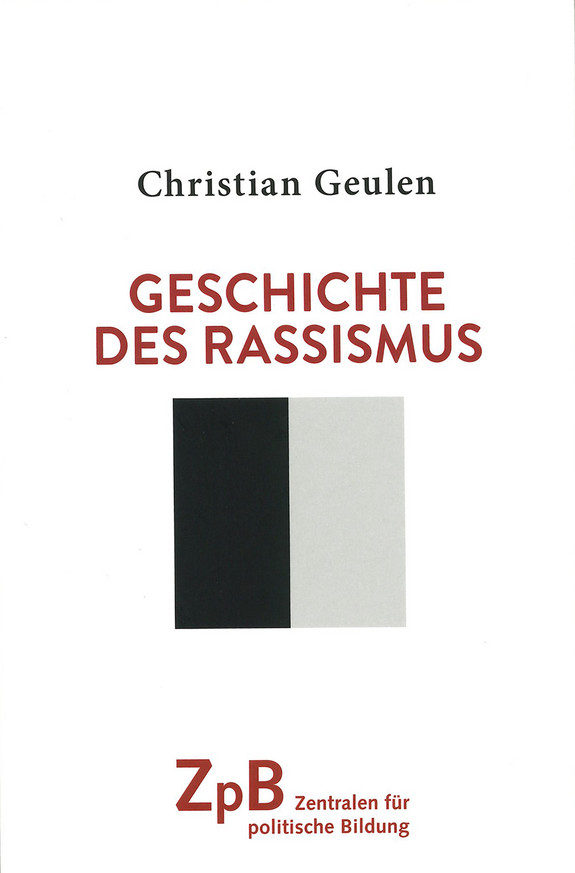
Geschichte des Rassismus
Umfassend und kompakt wird in diesem Buch die lange Entwicklung rassistischer Ideologien und Praktiken vom Altertum bis heute geschildert. Von der europäischen Expansion über den Sklavenhandel bis zu den imperialen, nationalen und totalitären Kontexten des 19. und 20. Jahrhunderts hat sich der Rassismus stetig weiterentwickelt. Das Buch gibt einen ganzheitlichen Überblick über die Geschichte des Rassismus.
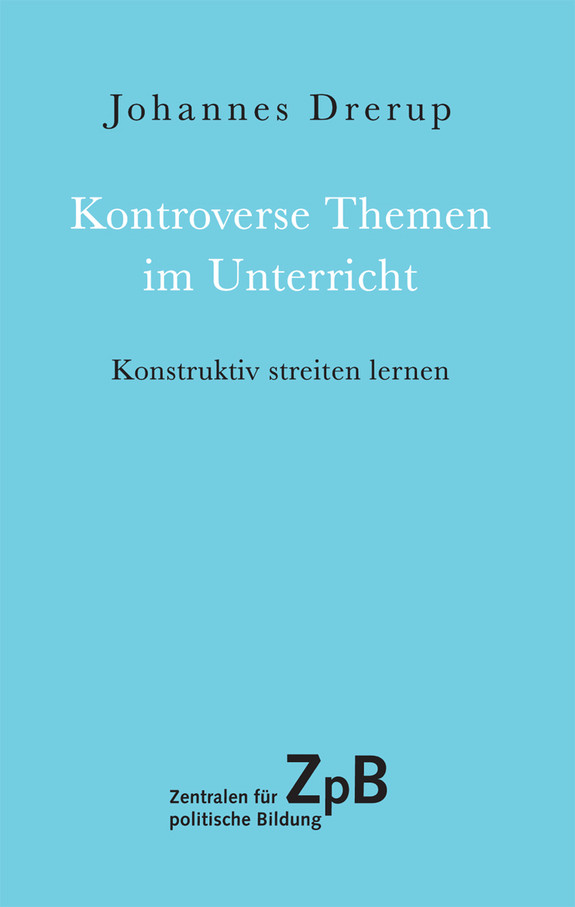
Kontroverse Themen im Unterricht
Angesichts wachsender gesellschaftlicher Polarisierung wird zunehmend unklar, welche Themen im Unterricht behandelt werden können und wie angemessenes Verhalten bei problematischen Einstellungsmustern aussieht. Johannes Drerup entwickelt in diesem Buch eine praktische Orientierungshilfe für ein unübersichtlicher werdendes Handlungsfeld.
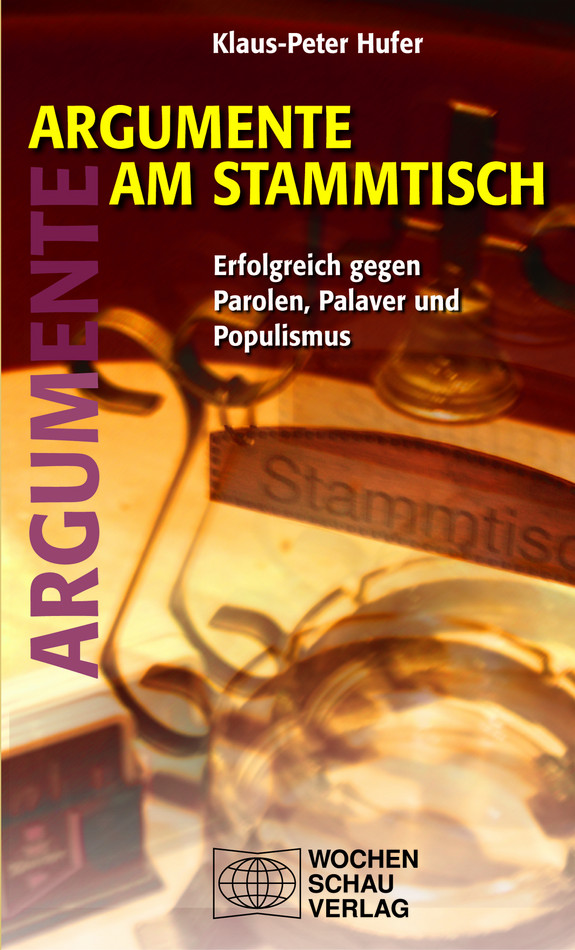
Verknüpfungen - Ansätze für die antisemitismus- und rassismuskritische Bildung
Die Handreichung wurde in Kooperation mit Verein „BildungsBausteine“ entwickelt und veröffentlicht. Sie enthält Methoden zur Auseinandersetzung mit Rassismus und Antisemitismus im Unterricht, die im Rahmen eines gleichnamigen Projekts entwickelt wurden. Die Handreichung enthält auch Methoden zur Thematisierung von Antisemitismus im Kontext des Nahostkonflikts.
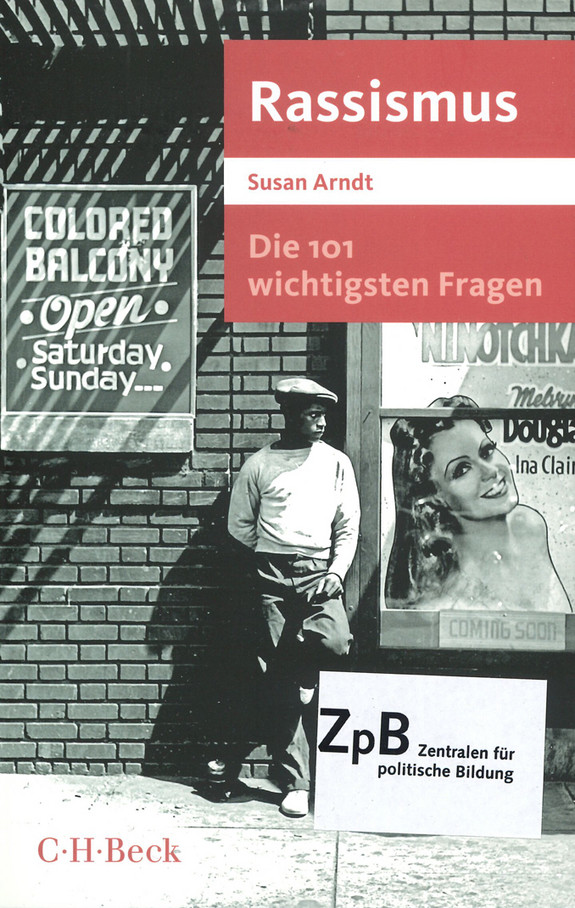
Die 101 wichtigsten Fragen: Rassismus
Wie spreche ich über Rassismus ohne ihn sprachlich zu reproduzieren? Woran erkenne ich rassistische Wörter? Wann nervt die Frage: „Wo kommst Du her?“. Brauchen wir ein neues Antidiskriminierungsgesetz? Und schließlich: Gibt es eine Welt ohne Rassismus? Das Buch bietet Einblicke in Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Rassismus, in das Wissen, das ihn trägt, und jenes, das ihn hinterfragt.
Filme für die politische Bildung
Bruder, Bruder, Bruder
Wer bin ich: Deutscher oder Ausländer? Wie wirkt sich kulturelle Vielfalt auf den Freundeskreis aus? Jugendliche verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen mit Rassismus, Diskriminierung und ihrem Umgang damit.
Ich geh dazwischen
Jugendliche verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft suchen Antworten auf die Fragen: Was tue ich, wenn jemand beleidigt, diskriminiert oder verletzt wird? Wo mische ich mich ein und wo nicht?
Woher kommst Du? Alltagsrassismus in Deutschland
Neun junge Leute erzählen von ihren alltäglichen Erfahrungen. Es sind Geschichten von körperlichen und verbalen An- und Übergriffen – nur weil sie anders aussehen, ihre Haut, ihre Augen oder ihre Haare dunkel sind. Sie werden bewusst ausgegrenzt, zu Fremden gemacht.
Not your fucking Mango
Ein ungewöhnlich differenzierter Blick auf rassistische Diskriminierung nicht nur von außerhalb, sondern auch innerhalb der BiPOC-Community.
Nicht in meinem Namen
Ein Porträt des gleichnamigen Anti-Islamismus-Projekts der AWO in Solingen, das sich gegen Diskriminierung, antimuslimischen Rassismus und den Missbrauch von Religion zu diesen Zwecken richtet.
CHAMPS ist wie ein Reisekoffer für mich
Das Wort „Champs“ kommt von „Champion“. Avin, Sami, Fatema, Darin, Fatima und Alan haben sich zu Champs ausbilden lassen. Der erste Teil unserer dreiteiligen Serie.
Angekommen?!
Sechs Frauen und Männer aus Syrien und dem Irak blicken einige Jahre nach ihrer Flucht zurück auf ihre Wünsche und Vorstellungen bei ihrer Ankunft. Was hat sich erfüllt? Was nicht? Wie bewerten sie ihr heutiges Leben in Deutschland?
Ruhrgebietskinder: Die neue Generation
Haticeela, Emre B., Emre C., Furkan, Merve und Soufian sind die neue Generation von Ruhrgebietskindern. Sie geben hier einen Einblick in ihre Träume und Wünsche.
Aufklärung, Austausch und Qualifizierung in NRW
Die Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Rassismus (LKS) ist zentrale Anlaufstelle in den Themenfeldern Rechtsextremismus und Rassismus in Nordrhein-Westfalen. Hauptaufgaben sind die Vernetzung staatlicher und nichtstaatlicher Akteure in NRW sowie die Förderung von Beratungsstellen und -angeboten.
Zur Seite der Landeskoordinierungsstelle mit den Beratungs- und Qualifizierungsangeboten
Die 42 ADA-Beratungsstellen in NRW unterstützen Menschen, die diskriminiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf Menschen, die rassistische, antisemitische, ethnische und religiöse Diskriminierung erleben. Sie können nach Themenbereichen filtern, um die für Sie passende Hilfe zu finden. Zu den Beratungsangeboten
Die Stiftung Leben ohne Rassismus führt Musterklagen gegen Verstöße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und bietet auch sonst umfangreiche Unterstützung. Zum Angebot der Stiftung Leben ohne Rassismus
Auch Menschen, die selbst von Rassismus betroffen sind, schließen sich zu Vereinen und Verbänden zusammen, um andere Menschen zu beraten und zu unterstützen. Einen Überblick über solche community-basierten Beratungs- und Anlaufstellen finden Sie auf den Seiten der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Zur Karte mit den Initiativen